Musik & Emotion
Musik & Emotion
Und da ist er wieder, dieser Ohrwurm, der unbemerkt mitgesummt wird und im Alltag immer wieder seinen Platz findet. Doch von wo ist diese Melodie bekannt, die noch dazu gute Laune macht? Beim Einschalten des Fernsehers wird erkennbar, dass es eine Werbemelodie ist, die ein täglicher musikalischer Begleiter wurde.
Einleitung
Oftmals sind es nicht nur Melodien, die sich in unser Gedächtnis brennen, sondern auch ganze Textpassagen von Werbesongs wie bspw. Vollbepackt mit tollen Sachen usw. Doch wie kann das sein? Bedenkt man, dass es manchmal durchaus schwierig ist, sich an alles zu erinnern, was für den Großeinkauf gebraucht wird, oder wie lange es braucht ein Gedicht auswendig zu lernen, ist es bemerkenswert, wie schnell sich Melodien und Texte der Werbung in unser Gedächtnis einprägen und wie schnell mitunter auch die Laune bei deren Mitsingen/-hören oder auch -summen steigt. Was macht also dieser Ohrwurm mit der eigenen Emotion?
Sowohl Emotionen als auch Musik begleiten uns täglich und beeinflussen bewusst und unbewusst unseren Alltag, unsere Entscheidungen und zeigen, dass sie miteinander ein tolles Team bilden.
Schon Paul Watzlawick (2017) sprach davon, dass der Mensch nicht NICHT kommunizieren kann und Musik ist neben der Sprache eine kulturübergreifende Form der Kommunikation.
Was sind Emotionen?
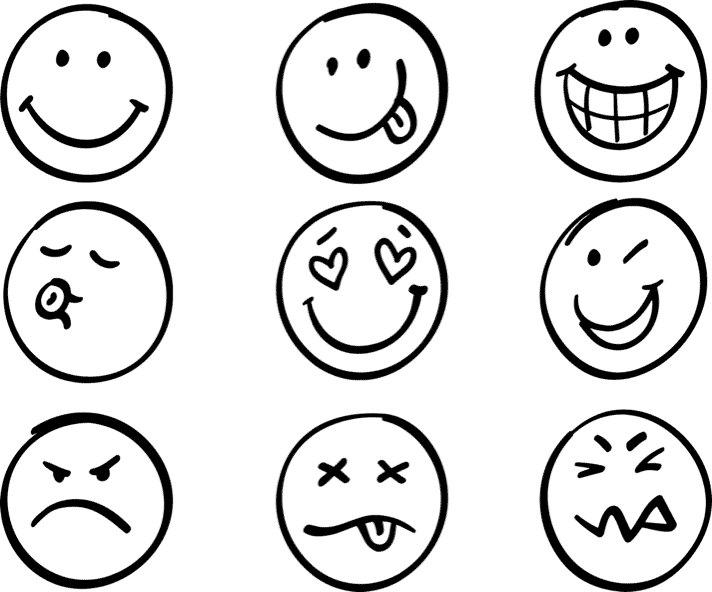
Das tägliche Leben konfrontiert uns mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Omnipräsent dabei sind die verschiedensten Emotionen, die unser Handeln, Denken, unsere Wahrnehmung wie auch den Umgang mit unseren Mitmenschen beeinflussen.
Die Emotionspsychologie ermöglicht unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge, aus denen sich folgende Bausteine für Emotionen ergeben: einer subjektiven (ein spezifisches Gefühl, das für das eigentliche Erleben der Emotion notwendig ist), einer kognitiven (ein spezifischer Gedanke), einer physiologischen Komponente (körperliche Aspekte, die mit der Emotion einhergehen wie bspw. rotes Gesicht, erhöhter Blutdruck etc.) und der Komponente die für das Außen am leichtesten wahrnehmbar ist – der spezifische Gesichtsausdruck auch als expressive Komponente bezeichnet. (Bradley & Lang 2006) Die motivationale bzw. handlungsbezogene Komponente hilft uns, Umstände und gefährliche Zustände zu vermeiden oder angenehme und freudvolle Konstellationen zu suchen. (Rothermund & Eder 2011)
Mees (2006) beschreibt in seiner Skizze Zum Forschungsstand der Emotionspsychologie den Menschen als das emotionalste aller Lebewesen. Dies gelingt durch die außergewöhnlichen menschlichen kognitiven Fähigkeiten und Prozesse. Diese ermöglichen die Erfassung und Evaluierung von Situationen, Impulsen und Reizen, sodass eine Bewertung der Situation (handelt es sich um eine Bedrohung?) und folglich der Emotionsart und Intensität vorgenommen wird. (Lazarus 1994) Durch die Sprache wird eine Art allgemeingültiges Grundwissen der Emotion vermittelt, jedoch ist das Erleben der jeweiligen Emotion individuell, da von der Bewertung abhängig. Der Duden kann zwar das Wort Liebe definieren als
„starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem [nahestehenden] Menschen“ (Dudenredaktion 2019)
jedoch kann der Duden das Gefühl des emotionalen Erlebens nicht beschreiben und auch nicht definieren, da dies individuell und subjektiv ist. Subjektiv, da auch die Qualität der Emotion von der persönlichen Bewertung abhängt, während die Intensität der Emotion bestimmte Indikatoren beansprucht wie Atmung, Puls, Handlungen, Gedanken, Erinnerungen etc.
Und so stellte auch Mees (2006) fest, dass Emotionen kognitiv und nicht durch Rezeptoren verursacht werden.
Dies sei am folgenden Beispiel veranschaulicht: Der Duden kann das Wort Liebe definieren, doch wie intensiv diese empfunden wird, hängt von der individuellen Bewertung ab. Mit steigender Intensität der Emotion treten mehr körperliche Aspekte auf, werden mehr Gedanken in diese Emotion investiert und das Erleben wird dadurch immer intensiver.
Gerade das Erinnern an die erste große Liebe kann vermutlich viele Aspekte dieses Beispiels beinhalten. Angemerkt sei hier, dass sich der Kreislauf des intensiven emotionalen Erlebens sowohl in die positive als auch in die negative Richtung entwickeln kann.
Ist keiner oder nur einer der oben genannten emotionalen Bausteine vorhanden, so spricht man von einem bloßen Urteil, wie dies oft beim Essen in einem Restaurant geschieht wie bspw. „Das Gulasch ist gut“. (Mees 2006)
Wie entstehen Emotionen?
Zwei Möglichkeiten bieten sich an. (Lazarus 1994) Zum einen durch die Wahrnehmung und Einschätzung der
„emotionalen Bedeutung von Ereignissen, Taten und Personen für die Anliegen der bewertenden Person.“ (Mees 2006)
Zum anderen gibt es die Varianten des Primings. Negative Erfahrungen, stereotype Vorstellungen können nicht nur Stress verursachen, sondern auch negative Emotionen und erschweren bspw. das Erlernen von neuen Sprachen, das Lernen im Allgemeinen oder auch von motorischen Inhalten wie bspw. Tanzen. (Levy 2003)
Im Falle des semantischen Primings, das erstmals von Lashley (Rosenbaum u. a. 2007) im Rahmen eines Vortrages im Jahr 1951 beschrieben wurde und eine Reaktion basierend auf früheren Ereignissen und deren verkürzte Reaktionszeit erklärt. Die Gedächtnisforschung (Warrington & Weiskrantz 1974) bestätigte Lashleys Untersuchungen und Collins & Loftus (1975) zeigten, dass unser Gedächtnis aus miteinander verknüpften Knoten besteht, die es ermöglichen, dass ein Wort (Primerreiz) ein analoges Konzept im Gedächtnis aktiviert und auf einen Targetreiz reagiert werden kann. Dies erfolgt in einer kurzen Reaktionszeit völlig automatisiert und unbewusst. Das semantische Priming zeigt, dass Reaktionen und Verhalten erlernt und automatisiert werden können. Daneben gibt es noch das affektive Priming (Fazio 2001), das sich auf Einstellungen und der damit einhergehenden automatisierten Bewertung von Objekten bezieht, und das Konzept des emotionalen Primings, das auf der emotions- und motivationsbasierten Forschungsarbeit von Lang (1998) beruht. Laut seines Konzeptes handelt es sich um ein Netzwerk, das sowohl Reizinformation (Ereignisse), Reaktion (Verhalten, Sprache etc.) als auch Aktion (Muskelreaktion, Schweißbildung, etc.) beinhaltet. Ähnlich dem affektiven Priming können auch emotionale Muster und deren Reaktion und Aktion gebahnt werden und es erfolgt nach dem Primerreiz eine unbewusste und schnelle Verarbeitung. Daraus ergibt sich, dass Emotionen nicht nur durch Stimmung, sondern auch in der Körperhaltung und im Gesichtsausdruck ersichtlich werden. (Kößler 2006)
Der Gesichtsausdruck ist jedoch nicht generalisierbar und seit fast 150 Jahren (Darwin 1872) Gegenstand intensiver Forschung. Seit der Studie Ekmans (1999) ist bekannt, dass sich der Gesichtsausdruck für spezifische Emotionsgruppen (bspw. Angst, Freude, Ärger, Ekel, Leid, Trauer) in unterschiedlichen Völkern und Zivilisationen interessanterweise ähnelt bzw. gleicht. Die Studie folgerte daraus, dass die oben genannten Emotionen im engen Miteinander für das menschliche Überleben standen, der Gesichtsausdruck sich evolutionsbedingt entwickelte und dadurch generalisieren lässt. Dem ist entgegenzuhalten, dass Emotionen auch abseits der evolutionären Entwicklung vor allem durch das soziale Umfeld, die Kultur, das Erleben selbst geprägt und vermittelt werden. So stellte Fiehler (2012) sogenannte Emotionsregeln auf, in denen erklärt wird wann (Erlebnisregel), wie (Bewältigungsregel) und wodurch (Korrespondenzregel) eine Emotion erfahren werden kann.
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass negative Emotionen wie Angst oder Ekel eine wesentlich größere Auswirkung auf unser Verhalten haben als positive Emotionen und das von frühester Kindheit an. Dies liegt an der sogenannten Negativitätsbias die erklärt, dass negative Faktoren eine höhere Auswirkung auf die getroffenen Entscheidungen, die Aufmerksamkeit und auch andere kognitive Prozesse haben.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass aktuelle Situationen mit und durch ein spezifisches Merkmal frühere emotionale Bedeutungen wieder aktivieren können, wie bspw. Angstattacken bei Kriegsveteranen.
Emotionen ziehen auch spezifische Handlungen nach sich. So sind die Emotionen Angst und Furcht für einen evolutionsbedingten Fluchtreflex verantwortlich. (Mineka & Öhman 2002)
Grundsätzlich will das menschliche Handeln den Istzustand, sofern er gut ist erhalten oder eben verbessern und eine Verschlechterung des Istzustandes soll tunlichst vermieden werden. So handelt der Mensch, weil er Spaß an einer Sache hat (direkt annäherungsmotiviert), weil er negative Emotionen vermeiden möchte (direkt vermeidungsmotiviert), weil es Mittel zum Zweck ist (indirekt annäherungs- oder auch vermeidungsorientiert). Der Mittel zum Zweck ist bei Diäten zu finden: Ich esse weniger, um in ein Kleidungsstück der Größe XY zu passen und bin stolz, wenn ich das geschafft habe. Dies wäre ein Beispiel für indirekt annäherungsmotiviert. (Mees 2006)
Dies war ein kurzer Einblick in die Entstehung unserer Emotionen und ihr Einfluss auf unser Tun. Mehr dazu in diesem Beitrag Unterschied von Emotion, Gefühl & Stimmung.

